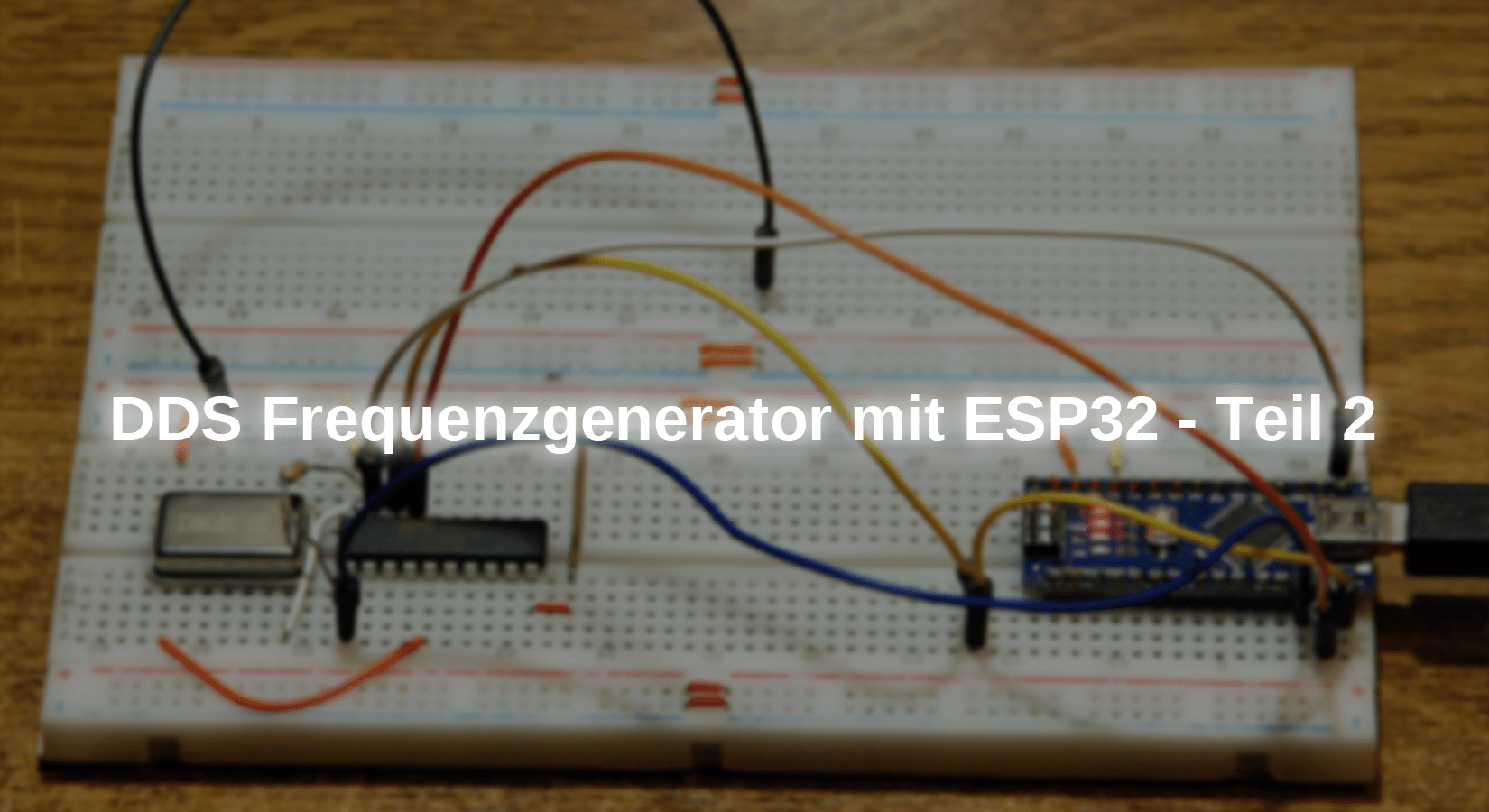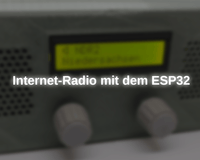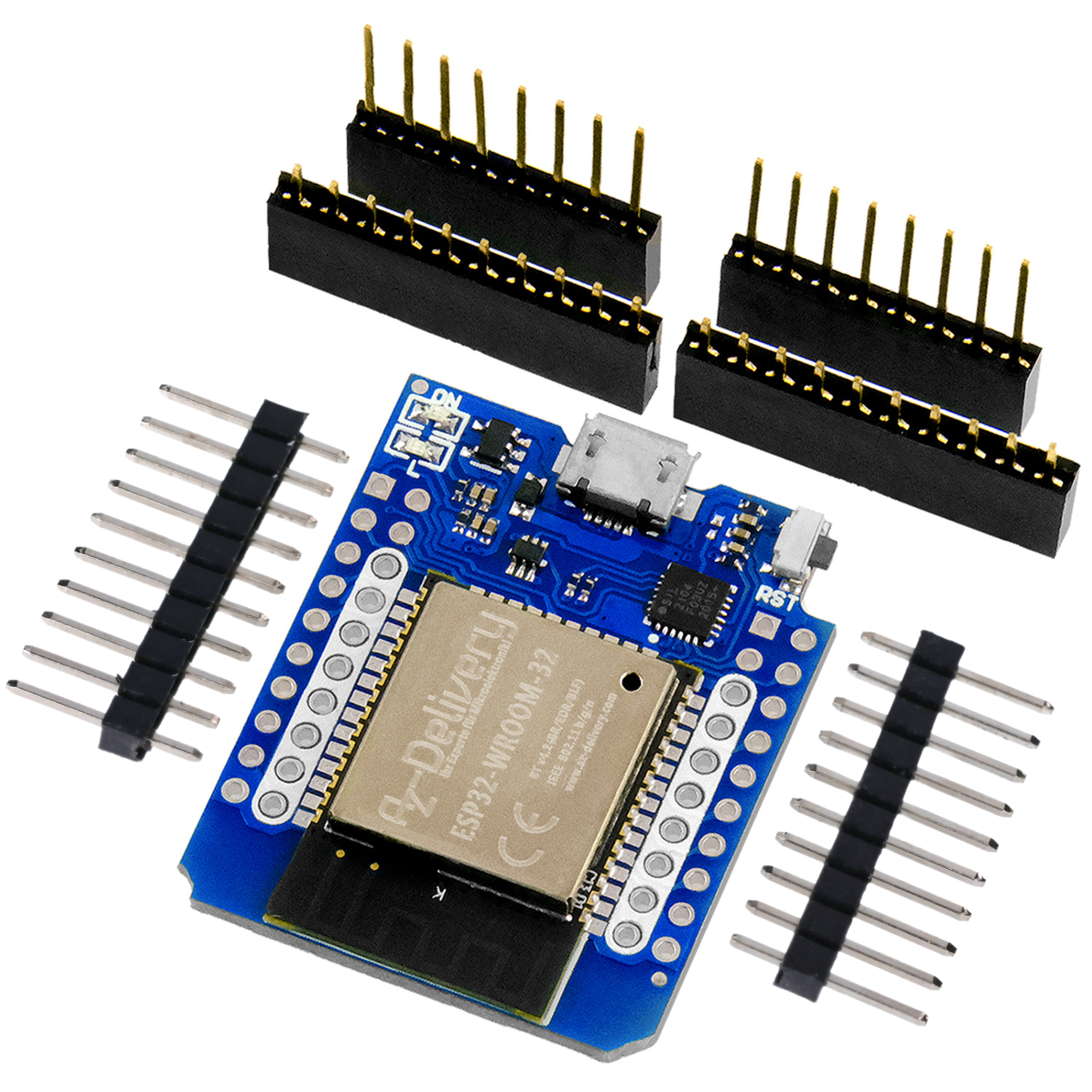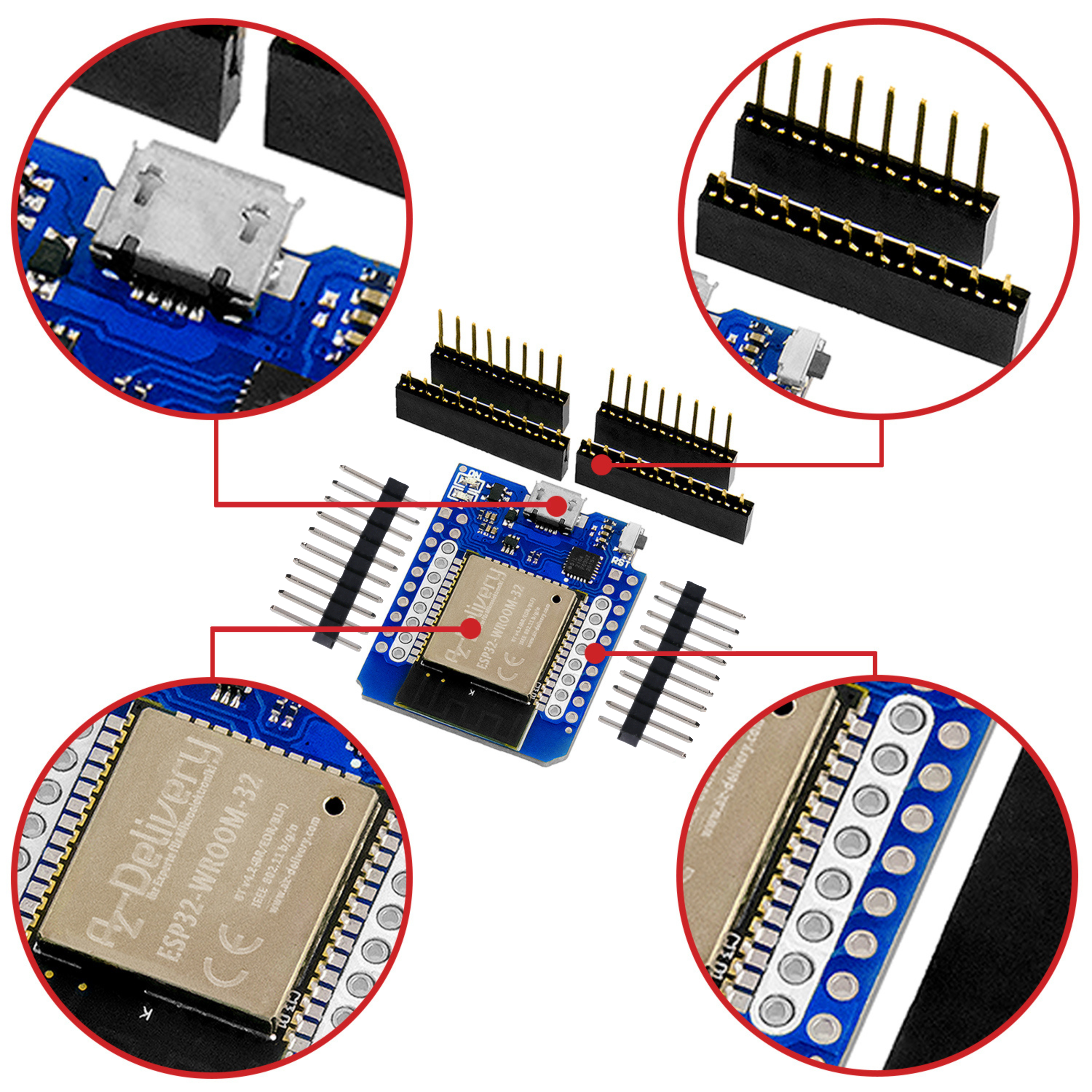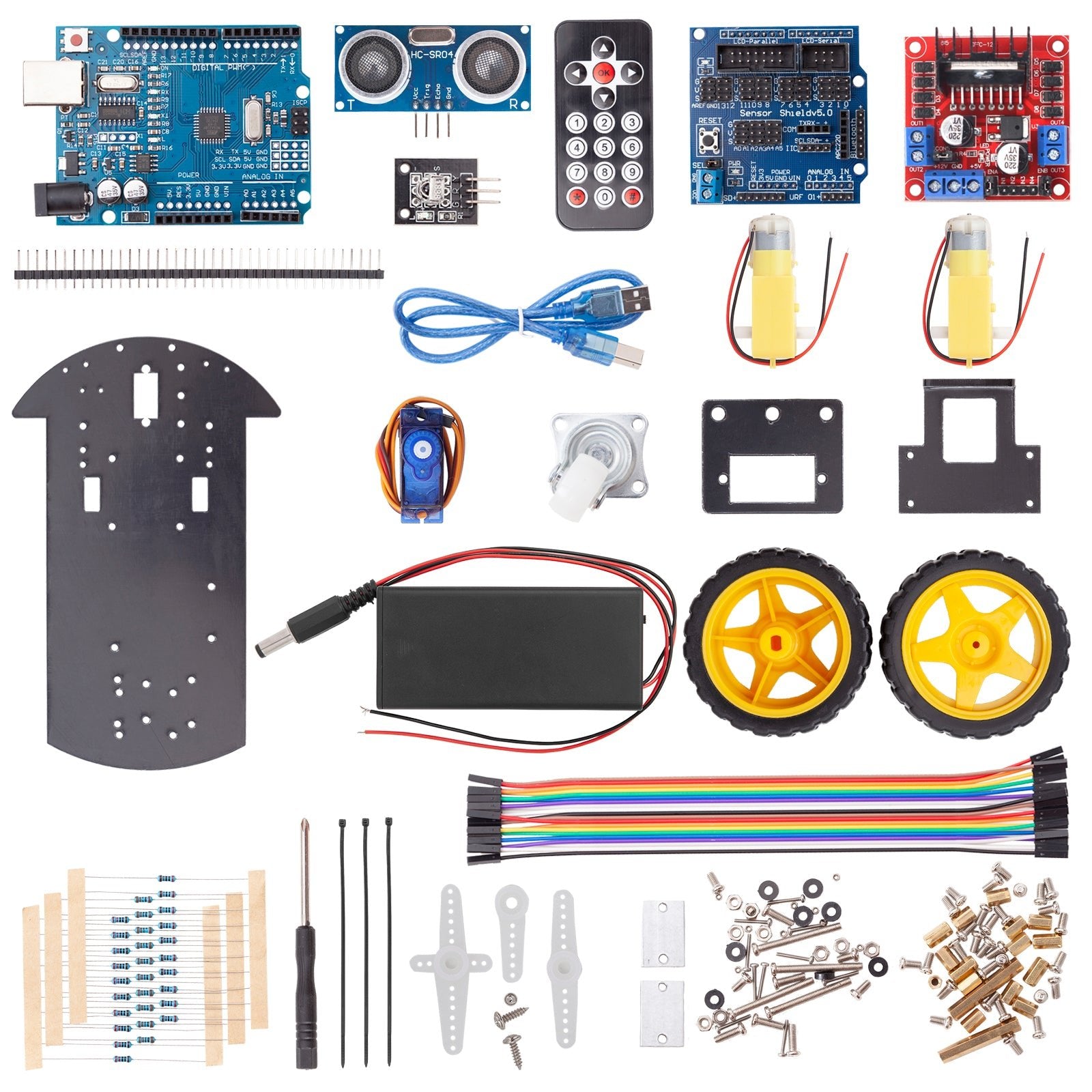Diesen Beitrag gibt es auch als PDF-Dokument.
In der vorangegangenen Episode hatten wir die DDS-Fähigkeiten (Direkte Digitale Synthese) des ESP32 untersucht. Auf der Jagd nach schnelleren Lösungen für unseren DDS-Generator müssen wir nach einem Micro-Controller suchen, der einen acht Bit breiten Port bietet und mit einem externen Taktsignal versorgt werden kann. In Frage kommen entweder die Riesen von Microchip, vormals ATMEL AT Mega 16 und AT Mega 32 oder, weil wir nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen wollen, der Zwerg, ein AT Tiny 2313. Ich habe mich für den Kleinen entschieden, weil Port B die geforderten acht Ausgangs-Leitungen zur Verfügung stellt und weil er mit einem genauen, externen Quarzoszillator bis 20MHz versorgt werden kann, statt wie beim AT Mega16/32 nur mit 16 MHz. Welche Werkzeuge zum Verfassen und Programmieren eines AT Tiny 2313 erforderlich sind und wie man mit ihnen arbeitet, das erfahren Sie in der heutigen Episode aus der Reihe
MicroPython auf dem ESP32 und ESP8266
heute
Der ESP32 bekommt schnelle Verstärkung
Was steht also heute an?
· Beschaffung und Installation von ATMEL-Studio 7.0
· Beschaffung und Installation der Arduino IDE
· AZ-Arduino Nano V3 als Programmer von ATMEL-Chips einrichten
· Beschaffung und Einrichtung der Programmer-Software
· Assembler-Test-Programm für den AT Tiny 2313 erstellen und brennen und testen
Unser ESP32 kann sich heute erst einmal ausruhen, während wir uns um seinen schnellen DDS-Helfer kümmern. Was wird dafür an Hardware gebraucht?
Die Hardware
|
1 |
Nano V3.0 CH340 Chip oder AZ-Nano V3-Board mit USB-C Anschluss mit Atmega328 CH340 fertig verlötete, verbesserte Version |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Quarzoszillator 20MHz |
|
1 |
AT Tiny 2313 (A) |
|
1 |
Widerstand 10,0 kΩ |
Im Lauf der Projektentwicklung brauchen wir zwei Breadboards, die an den Längsseiten über zwei Stromschienen zusammengesteckt werden, damit der Controller, der Quarzoszillator, die Widerstände und der Arduino Nano Platz haben.
Der erste Teil des Aufbaus zum Brennen des Flash-Inhalts des AT Tiny 2313 ist sehr einfach, wie die Abbildung 1 zeigt.

Abbildung 1: Schaltung zum Brennen des Flash-Inhalts beim ATTiny2313
Bevor wir ans Werk gehen, brauchen wir aber noch ein paar Softwarebausteine.
Die Software
Fürs Flashen und die Programmierung des AT Tiny 2313:
AVRDude ( in der Arduino IDE enthalten)
Signaldarstellung:
Die AT Tiny 2313-Programme zum Projekt:
tinytest.asm erstes Testprogramm
Wie kommt das Programm auf den AT Tiny 2313?
Was Thonny für die Entwicklung von MicroPython-Programmen ist, ist ATMEL-Studio 7.0 für das Schreiben von Assembler- (oder C++ -) Programmen für ATMEL-Bausteine. Mit Hilfe von Thonny schicken wir Daten und Firmware direkt über die USB-Leitung zum Controller.
Für ATMEL-Chips brauchen wir zum Brennen von Programmen einen sogenannten Programmer, der die Daten vom USB-Bus in ATMEL-konforme Signale umsetzt. Ideal ist ein AVR MK II (Preis um die 20 €), weil dieses Bauteil direkt aus dem ATMEL-Studio 7.0 heraus angesprochen werden kann und so den Programmierprozess deutlich vereinfacht.

Abbildung 2: AVR-MK II Programmer von ATMEL
Aber es geht auch billiger, wenn man nur mal zwischendurch einen ATMEL-Controller programmieren möchte und dafür etwas mehr Umstände in Kauf nimmt. Es geht nämlich auch mit einem Arduino-Clone. Das kann ein Mikrocontroller Board AZ-ATmega328, ein AZ-Mikrocontroller Board LGT8F328P oder ein AZ-Nano V3- sein. Weil meist irgendwo ein Arduino-Derivat verstaubt in einer Ecke rumliegt, habe ich mich für letztere Variante entschieden. In diesem Beitrag spielt ein AZ Nano V3 die Programmer-Rolle. Damit der Nano lernt, Programmer zu spielen, brauchen wir erst einmal die Arduino IDE.
Arduino-IDE besorgen und installieren
Laden Sie die Installationsdatei herunter und speichern Sie sie in einem beliebigen Verzeichnis.

Abbildung 3: Installationsdatei herunterladen
Im nächsten Fenster haben Sie die Wahl – mit oder ohne Spende herunterladen.

Abbildung 4:Sie haben die Wahl
Den Datenschutzbestimmungen müssen Sie zustimmen, eine e-Mailadresse brauchen Sie nicht anzugeben.

Abbildung 5: Den Datenschutzbestimmungen zustimmen
Navigieren Sie jetzt zum Zielverzeichnis und OK.

Abbildung 6: Datei abspeichern
Wechseln Sie nun im Explorer in das Zielverzeichnis und starten Sie die Installationsdatei.

Abbildung 7: Installation ausführen
Die Lizenzvorgaben müssen akzeptiert werden, danach wählen Sie die Benutzergruppe aus.

Abbildung 8: Lizenzabkommen annehmen
Um die Arduino IDE für alle Benutzer freizugeben, müssen Sie Admin-Rechte haben.

Abbildung 9: Benutzerauswahl
Bestätigen Sie am besten die Vorgabe des Zielverzeichnisses für die Installation.

Abbildung 10: Verzeichnisauswahl bestätigen
Nachdem die Installation beendet ist, lassen Sie die IDE gleich einmal starten.

Abbildung 11: Installation abschließen
Nun laufen einige weitere Schritte automatisch ab. Die Treiber für den USB-Zugriff lassen wir installieren.

Abbildung 12: Treiber für USB-Zugriff installieren
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Arduino-Board mit dem PC zu verbinden, damit im übernächsten Schritt die virtuelle COM-Schnittstelle erkannt und zur Auswahl angeboten wird.
Die IDE bietet weitere Komponenten zur Einrichtung an, wir lassen das Update zu und lassen alles installieren, dann brauchen wir uns später nicht mehr darum zu kümmern.

Abbildung 13: Startfenster nach der Installation
Die IDE zeigt jetzt die verfügbaren COM-Ports an, wir wählen den richtigen aus und picken außerdem unser Board aus der Liste.

Abbildung 14: Port und Board-Auswahl
Port und Controller-Board können auch nachträglich über das Tools-Menü eingerichtet werden.

Abbildung 15: Boardauswahl über das Menü
Der Nano V3 wird ein ISP
Den AZ-Nano V3 in einen ISP (In System Programmer) zu verwandeln ist kein Kunststück. Der erforderliche Sketch wird in der IDE (Integrated Development Environment = Integrierte Entwicklungs-Umgebung) mitgeliefert. Wir holen ihn über das Menü Files – Examples – 11 ArduinoISP – ArduinoISP in den Editor.

Abbildung 16: Sketch ArduinoISP laden
Abschließend lassen wir den Sketch compilieren und schicken das Resultat zum Nano V3.

Abbildung 17: Sketch compilieren und hochladen
Leider können wir die Arduino IDE nicht direkt benutzen, um unsere eigenen Assemblerprogramme in den AT Tiny 2313 zu brennen. Aber die IDE liefert einen Hinweis, für eine andere Lösung. Wenn man im Ausgabefenster nach oben scrollt, findet man die Zeile mit dem Befehl, durch den die übersetzte hex-Datei des Sketches an den AT Mega 328 auf dem Nano-Board geschickt wurde. Da diese Übertragung über die USB-Verbindung läuft, können wir das Tool AVRDude, das hier aufgerufen wird, auch für unsere Zwecke verwenden. Dazu später mehr.

Abbildung 18: Aufruf von AVRdude
Wir kommen auf diese Zeile zurück, wenn wir das erste Assembler -Testprogramm zum AT Tiny 2313 schicken werden. Doch zuerst müssen wir dieses Programm schreiben und assemblieren und dabei hilft uns ein weiteres kostenloses Tool.
ATMEL-Studio 7.0 –
Entwicklungsumgebung für ATMEL-Chips
ATMEL-Studio 7.0 ist ein Verbund von Editor, Assembler, Debugger, Simulator und Disassembler. Schauen wir uns an, wie man mit dem Programm ein Assemblerprogramm schreibt, testet, übersetzt und zum Controller hochlädt.
Laden Sie erst einmal die Installationsdatei herunter und speichern Sie diese in einem Verzeichnis Ihrer Wahl. Navigieren Sie zum Downloadverzeichnis und starten Sie die Installation.
Den Lizenzvereinbarungen müssen wir zustimmen, damit die Installation beginnt.

Abbildung 19: Den Lizenzvereinbarungen zustimmen
An Controllern brauchen wir lediglich die 8-Bit-Familie.

Abbildung 20: Controllerfamilie auswählen
Auch die Beispiele können wir gegebenenfalls brauchen.

Abbildung 21: Erweiterungen mit installieren
Den Systemcheck quittieren wir mit Next, falls alle Punkte einen grünen Haken haben.

Abbildung 22: Systemcheck Ergebnis
Nach der gelungenen Installation starten wir auch gleich zur ersten Assemblersitzung durch.

Abbildung 23: Installation beendet
Auf der Startseite stoßen wir ein neues Projekt an – New Project.

Abbildung 24: Oberfläche nach dem ersten Start
Für das Assembler-Projekt vergeben wir einen Namen - tinytest. Zur Speicherung der Projektdateien wird ein Verzeichnis gleichen Namens angelegt.

Abbildung 25: Neues Projekt anlegen
Jetzt müssen wir nur noch den Controllertyp auswählen - AT Tiny 2313(A) – dann öffnet sich das Editorfenster. Dort hin Kopieren wir den Programmtext aus der Datei tinytest.asm, nachdem wir den vorgelegten Text gelöscht haben. In unserem Projekt wird daraus somit die Datei main.asm.
Das erste Assemblerprogramm
Was ist Assembler?
Assembler ist eine maschinennahe Sprache. Durch die Verwendung von sogenannten Mnemoniks wird dem Programmierer erspart, dass er sich alle Hex-Codes der Maschinenbefehle und deren Zusammenwirken mit Daten merken muss. Die meisten Befehle setzen sich aus einem Befehlsteil und dem Datenteil zusammen. Für beide Bereiche sind entsprechende Bitpositionen reserviert. ATMEL-Studio 7.0 übernimmt den Job, den Befehlscode mit den nachfolgenden Parametern zu einem 16-Bit-Befehlswort zusammenzufügen und im Codeteil des Programms abzulegen. Alle Codes zusammen bilden das Maschinenprogramm, das dann im Controller ohne weitere Bearbeitung ausgeführt werden kann. Zum Vergleich, in MicroPython liegt das Programm als Script vor, das dann bei der Ausführung erst durch den Interpreter in Maschinencode übersetzt werden muss. Das macht MicroPython-Programme langsam.
Ähnlich wie bei einem C-Programm, gibt es aber keine Möglichkeit, Befehle interaktiv zu erkunden, wie das in MicroPython in REPL der Fall ist. Aber immerhin bietet ATMEL-Studio 7.0 mit seinem Debugger die Chance, das Programm schrittweise zu durchlaufen und dabei den Inhalt der Register und Speicherbereiche sowie IO-Operationen einzusehen und auf korrekte Ausführung der Operationen zu überprüfen.
Eine Liste von Befehls-Mnemoniks findet man im Datenblatt des AT Tiny 2313 auf den Seiten 257 und 258. Keine Angst, wir werden in unseren Programmen nur einen kleinen Teil davon verwenden.
Der Timingtest
Hinweis: AVR-Assemblercode ist nicht case sensitive, es wird also nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Wie bei unserem ESP32 wollen wir mal nachschauen, wie schnell der Kleine ist, wenn es um die Abfrage und Ausgabe von DDS-Daten geht. Wir orientieren uns dabei an dem Programm dds_generator_irq.py. Wieder lassen wir zwei Pins ein- und ausschalten und schauen mit dem Logic Analyzer nach, wie das Timing läuft.
Den Text des Programms, das wir jetzt besprechen, kopieren wir aus der Datei tinytest.asm in das Editorfenster von ATMEL-Studio 7.0, falls das noch nicht schon geschehen ist. Dadurch wird es zur Datei main.asm in unserem Projekt. Den Namen main.asm legt ATMEL-Studio 7.0 automatisch vor.
Konstanten werden mit .equ festgelegt. Wir weisen die Taktfrequenz unseres Quarzoszillators von 20MHz dem Bezeichner takt zu.
.equ takt = 20000000 ; 20 MHz ist der Systemtakt
Beim AT Tiny 2313 gibt es spezielle Speicherzellen, auf denen Operationen ausgeführt werden können, die Register. Beim AT Tiny 2313 gibt es davon 32 Stück. Sie erfüllen also die Aufgabe einer CPU. Auch Register können Alias-Namen erhalten. Hier werden die Register r16 bis r18 umbenannt. Zur Namensgebung von Registern wird .def verwendet.
.def temp1 = r16 ; Umbenennen einiger Register
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
Register können nur 8-Bit-Werte aufnehmen. Zum Verarbeiten von 32-Bit-Werten brauchen wir also jeweils vier Stück davon.
.def ddsp0 = r20 ; DDS-Phase
.def ddsp1 = r21 ;
.def ddsp2 = r22 ;
.def ddsp3 = r30 ;
.def ddsd0 = r24 ; DDS-Phasen-Increment
.def ddsd1 = r25 ;
.def ddsd2 = r26 ;
.def ddsd3 = r27
Anders als beim ESP32 haben wir beim AT Tiny 2313 nicht einzelne GPIOs, sondern Ports mit sechs (Port D) und acht Bits (Port B) Breite zur Verfügung. Das erlaubt uns überhaupt erst die simultane Ausgabe von acht Bits, was für den selbstkonstruierten DAC essentiell ist. Der AT Tiny 2313 besitzt keinen eingebauten DAC.
Für die Messung des Timings setzen wir die Pins PortD.4 und PortD.6 ein. Der Port ist ebenfalls ein Register, das aber zu keinen arithmetischen oder logischen Operationen fähig ist. Zu jedem Port gehört ein Daten-Richtungs-Register, das festlegt, welches Pin als Eingang (DDR-Bit = 0) oder Ausgang (DDR-Bit=1) ist. IO-Register haben einen eigenen Adressbereich, der von 0x00 bis 0x3F reicht. Neben den Ein- Ausgabe-Registern befinden sich in dem Adressbereich weitere Register, die die zum Beispiel die Funktion der Timer, Schnittstellen etc. steuern.
.equ loopPin = 4
.equ timerPin = 6
.equ mPort = portD ; portD = 0x12
.equ mDDR = ddrD ; ddrD = 0x11
Die Samplefrequenz für unsere DDS-Anwendung ergibt sich aus den Messungen, die wir später durchführen werden. isrValue ist ein Vergleichswert für den Hardwaretimer durch den die IRQ-Folgefrequenz festgelegt wird. Erreicht der Timer diesen Wert, dann wird er zurückgesetzt und beginnt erneut Systemtakte zu zählen. Ein Systemtakt entspricht bei 20MHz einer Zeitspanne von 50ns. Bei 40 Systemtakten kommen wir somit auf 2µs IRQ-Folgezeit.
; Maximale Samplefrequenz: 20000000 Hz / 24 = 833333 Hz
; gewählte Samplefrequenz: 500 kHz
; TOP-Wert für Timer1:
;
.equ isrValue = 20000000 / 500000 ; = 40
Die Berechnung des DDSd-Werts erfolgt in der gleichen Weise wie im vorangegangenen Beitrag. Wegen der Beschränkung von ATMEL-Studio 7.0 auf 32-Bitzahlen muss man bei der Berechnung einen Klimmzug machen. Wir dividieren zuerst 231 durch die Samplefrequenz in kHz und multiplizieren dann noch mit 2. Im späteren Produktionsbetrieb erledigt diese Berechnung der ESP32 und sendet den Kleinen nur noch den fertigen DDSd-Wert.
; DDS-Versatz für 1kHz Ausgangssignal
; ddsd / 2^32 = 1000 / 500000 oder
; ddsd = 1kHz/500kHz*(2^32)=8589934
.equ ddsd = EXP2(31) / 500 * 2;
Die Kurvendaten hatten wir beim ESP32 in Form von Listen abgelegt. In Assembler gibt es keine Listen. Stattdessen legen wir die DDSs-Daten als Bytes (.db = define Byte) im Programmspeicher (.cseg = Code Segment) ab der Adresse 0x0200 ab. mit den 128 RAM-Bytes des AT Tiny 2313 hätten wir da eh keine Chance. Weil der Programmspeicher in Words (zwei 8-Bit-Speicherstellen = ein Word) organisiert ist, landen die Sinus-Werte also an Byteposition 0x0400.
; ***********************************************************
; * Kurvendaten
; ***********************************************************
.cseg
.org 0x0200
Sinus:
.db 128, 131, 134, 137, 140, 144, 147, 150
.db 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174
.db 177, 180, 182, 185, 188, 191, 194, 196
.db 199, 201, 204, 206, 209, 211, 214, 216
.db 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
.db 234, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 244
.db 246, 247, 248, 249, 250, 251, 251, 252
.db 253, 253, 254, 254, 254, 255, 255, 255
.db 255, 255, 255, 255, 254, 254, 253, 253
.db 252, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246
.db 245, 244, 242, 241, 240, 238, 236, 235
.db 233, 231, 229, 227, 225, 223, 221, 219
.db 217, 215, 212, 210, 208, 205, 203, 200
.db 197, 195, 192, 189, 187, 184, 181, 178
.db 175, 172, 169, 167, 164, 160, 157, 154
.db 151, 148, 145, 142, 139, 136, 133, 130
.db 126, 123, 120, 117, 114, 111, 108, 105
.db 102, 99, 96, 92, 89, 87, 84, 81
.db 78, 75, 72, 69, 67, 64, 61, 59
.db 56, 53, 51, 48, 46, 44, 41, 39
.db 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23
.db 21, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 11
.db 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4
.db 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1
.db 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
.db 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10
.db 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22
.db 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
.db 40, 42, 45, 47, 50, 52, 55, 57
.db 60, 62, 65, 68, 71, 74, 76, 79
.db 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103
.db 106, 109, 112, 116, 119, 122, 125, 128
Im Programmspeicherbereich sind die Words an den Adressen 0x0000 bis 0x0012 für die Interruptvektoren reserviert. An die hier hinterlegten Programmadressen springt die Programmausführung, wenn eine der 13 Interruptquellen aktiv wird. Wir setzen den Programmzeiger auf die Adresse 0x0000: .org 0x0000. Dort steht ein Sprung (rjmp) zum Start-Label des Programms. An der Adresse 0x0005 steht ein Sprung zur ISR (Interrupt Service Routine), die sich um den Überlauf des Timers 1 kümmert.
*************************************************************
; * IRQ-Vektoren
**************************************************************
.org 0x0000 ; Programmstart
rjmp Start ; Resetvektor
.org 0x0005 ; Timer1 Overflow Pointer
rjmp t1ovl
Hinter allen IRQ-Vektoren kann das Programm beginnen.
.org 0x0013 ; hinter allen IRQ-Vektoren
*************************************************************
; * Hauptprogramm Vorbereitungen
*************************************************************
Beim Programmstart muss zunächst der Stackpointer initialisiert werden. Der Stack ist ein Teil des RAM-Speichers und wird zum Beispiel benötigt, um beim Aufruf einer Unterprogramm-Routine die Rücksprungadresse zu speichern. Der Stack liegt am Ende des RAM-Bereichs und wird von oben nach unten gefüllt. Wir laden das LSB der Adresse des RAM-Endes direkt (immediate) in das Register r16. Und schaufeln den Wert in das LSB des Stackzeigers (Stack Pointer Low), Das ist das Register 0x3D im IO-Bereich.
Start:
ldi temp1, low(ramend) ; Stackpointer setzen
out spl, temp1
Wir setzen den Phasenzeiger ddsp auf Anfang und belegen das Inkrement DDSd vor, indem wir die Register direkt mit den Werten laden. Den zuvor berechneten DDSd-Wert zerlegen wir in die vier Bytes. Das geht hier übersichtlicher als in MicroPython.
ldi ddsp0,0 ; Phasen-Register auf 0
ldi ddsp1,0
ldi ddsp2,0
ldi ddsp3,0
ldi ddsd0,low(ddsd) ; Phaseninkrement definieren
ldi ddsd1,high(ddsd)
ldi ddsd2,byte3(ddsd)
ldi ddsd3,byte4(ddsd)
Im DDR-Register setzen wir die Bits 4 und 6. Das macht die Leitungen des Ports zu Ausgängen (sbi = set Bit in IO), deren Zustand wir auf 0 setzen (cbi = clear Bit in IO) .
sbi mDDR, loopPin ; Leitung loopPin auf Ausgang
cbi mPORT, loopPin ; Pin low
sbi mDDR, timerPin ; Leitung loopPin auf Ausgang
cbi mPORT, timerPin ; Pin low
Bei Port B setzen wir alle Leitungen auf Ausgang.
ldi r16, 0b11111111 ; PortB auf Ausgang
out ddrb, r16
Der Timer soll nach 40 System-Takten überlaufen, die sind erreicht, wenn er bis 39 gezählt hat. Der Timer arbeitet mit 16-Bit-Werten, deshalb müssen wir das MSB und LSB getrennt ermitteln und den beiden Bytes des ICR-Registers zuweisen. Das Handbuch des AT Tiny 2313 schreibt vor, dass das MSB vor dem LSB ausgegeben werden muss.
ldi r17, high(isrValue-1) ; Vergleichswert für Timer 1
ldi r16, low(isrValue-1) ; Modus 14
out icr1h, r17
out icr1l, r16
Bit 7 im Register timsk (0x39) schaltet den Timer 1-Overflow-IRQ frei.
ldi r16, 0b10000000 ; Timer 1 overflow enable
out timsk,r16
Wir verwenden den Modus 14 des Timers 1. Die genaueren Hintergründe zu erläutern würde hier zu weit führen. Für Interessierte empfehle ich die Seiten 97 ff und die Tabelle 12-5 auf Seite 113 des Handbuchs.
ldi r16, 0b00011001 ; Modus 14 setzen
out tccr1b, r16
ldi r16, 0b00000010
out tccr1a, r16
Das 16-Bit-breite Z-Register setzt sich aus den Registern r30 (zl) und r31 (zh) zusammen und dient in seiner Spezialaufgabe als Zeiger in den Programmspeicher dazu, dort abgelegte Daten mit dem Befehl lpm (load program memory) auszulesen. Der Byteblock der Wellenformen beginnt bei der Programmadresse 0x0200. Das entspricht der Byteadresse 0x0400. Mit dem MSB 0x04 füttern wir zh. zl wird später durch die ISR gesetzt. Danach lassen wir allgemein Interrupts zu. Der Befehl sei setzt das I-Flag im Statusregister sreg (=0x3F).
ldi zh, 0x02
sei
; *************************************************************
; * Hauptprogramm
*************************************************************
Die Hauptschleife hat nur die Aufgabe das loopPin PortD.4 ein- und auszuschalten, wie beim ESP32. rjmp führt einen relativ jump zum Label loop aus. Labels sind Einsprungadressen, stehen am Zeilenanfang und werden mit einem ":" abgeschlossen.
loop:
sbi mPort, loopPin ; an
cbi mPort, loopPin ; aus
rjmp loop
*************************************************************
; * IRQ-Service Routinen
*************************************************************
Auch die ISR des Timer-IRQs hat die gleiche Aufgabe wie beim ESP32 in der letzten Episode. Das timerPin, PortD.6, wird gesetzt, lpm holt über den Zeiger des Z-Registers einen Wert aus der Sinus-Tabelle. Ohne weitere Operanden geht der Wert in das Register r0, von wo er am Port B ausgegeben wird.
t1ovl:
sbi mPort, timerPin ; IRQ-Signal an
lpm ; Signalpegel nach r0 holen
out portb, r0 ; an Port B ausgeben
add ddsp0, ddsd0 ; Phasenwinkel erhöhen
adc ddsp1, ddsd1
adc ddsp2, ddsd2
adc ddsp3, ddsd3
cbi mPort, timerPin ; IRQ-Signal aus
reti
DDSp muss jetzt um DDSd erhöht werden. Die beiden LSBs werden einfach addiert (add). Dabei kann sich ein Übertragsbit ergeben, das bei den drei nächsten Additionen jeweils berücksichtigt werden muss (adc = add with carry). Bei der Addition steht im ersten Operanden zunächst der erste Summand und nach der Operation der Summenwert. Danach setzen wir das Bit 6 in Port D auf 0 und kehren vom IRQ zurück. ddsp3 ist der Alias für Register r30 = zl.
Mit der Taste F7 startet ATMEL-Studio 7.0 den Assemblierungsvorgang und zeigt das Ergebnis im Output-Fenster an. Wir suchen jetzt die Zeile mit dem Programmstart und klicken in grauen Rand neben der ersten Zeile danach. Der rote Punkt zeigt an, dass wir an dieser Stelle einen Breakpoint gesetzt haben.

Abbildung 26: Setzen eines Unterbrechungspunktes
Jetzt starten wir mit F5 eine Debug-Session. Der Simulator startet das Programm und bleibt beim Breakpoint stehen. Mit der Schaltfläche Prozessor Status schalten wir die Anzeige der Register ein. Mit der Taste F11 können wir durch das Programm wandern und im Fenster Prozessor Status die Belegung der Register verfolgen. Mit Strg+Shift+F5 schalten wir den Debugmodus aus.
Brennen des AT Tiny 2313
Jetzt fehlt nur noch die Übertragung des Programms auf den AT Tiny 2313. Mit dem MK II könnten wir jetzt einfach aus dem ATMEL-Studio 7.0 heraus das Programm übertragen. Um den Nano V3 als Programmer nutzen zu können, brauchen wir ein weiteres Programm, das den AVRISP im Nano V3 mit den korrekten Signalen ansteuern kann und das ist avrdude.exe.
Der Aufruf zum Brennen des Nano V3 aus der Arduino IDE heraus, ist, mit Verlaub, horrende lang. Es geht aber auch kürzer und vor allem direkt aus dem Verzeichnis heraus, in dem ATMEL-Studio 7.0 die übersetzte Assembler-Datei ablegt. Dorthin wechseln wir, nachdem wir ein Fenster der Eingabeaufforderung geöffnet haben.

Abbildung 27: Hier befindet sich die assemblierte Datei im Intel-Hex-Format
Unsere Datei heißt tinytest.hex und liegt im Intel-Hex-Format vor. Das Intel-Hex-Format dient seit 1975 dazu, Daten in Files so abzulegen, dass sie gesichert auf Speicherbausteine übertragen werden können. Ein Datensatz (eine Zeile, siehe unten) besteht aus dem Startbyte (:), dem Bytezähler (02), der Zieladresse im Chip 0x0000, dem Datentyp (02), den Datenbytes (0x00 0x00) und einer Prüfsumme (FC). Die Zeile endet mit Wagenrücklauf (0x0D) und Zeilenvorschub (0x0A). Jedes Byte wird durch zwei Hexadezimalziffern im ASCII-Format codiert. Genaueres kann man in diesem Wikipedia-Artikel nachlesen. Der Dateiinhalt unserer tinytest.hex lässt sich mit dem kostenlosen Hex-Editor HxD betrachten. In Abbildung 27 ist die erste Textzeile markiert:
:02 0000 02 00 00 46 43 0D 0A
Danach folgen die Sinus-Daten ab Byteadresse 0x0400.

Abbildung 28: Die ersten Bytes aus der Datei tinytest.hex
Ich gehe also jetzt in das Verzeichnis F:\___atmel\tinytest\tinytest\Debug, wo sich meine Datei befindet.

Abbildung 29: Eingabeaufforderung und Wechsel zum Zielverzeichnis
Der AT Tiny 2313 sollte nun wie in Abbildung 1 mit dem Nano V3 und dem Quarzoszillator verdrahtet sein. Zusätzlich schließen wir den Logic Analyzer an, um die Pegel an PortD.4 (Mainloop pulse an Kanal 1) und PortD.6 (IRQ pulse an Kanal2) aufzuzeichnen.

Abbildung 30: IRQ-Timing mit dem Logic Analyzer erfassen

Abbildung 31: Signalabtastung mit dem Logic Analyzer
Bevor wir zum "Brennen" des Programms schreiten, ist noch eine Geschichte zu klären, die oft Unwohlsein und Bauchgrimmen hervorruft, oder gar zum Ableben des Controllers führen kann. Das ist der Umgang mit den Fuses. ATMEL-Controller haben neben dem Programm- RAM- und EEPROM-Speicher einen Speicherbereich von vier Bytes, die das Startverhalten und weitere Parameter des Chips einstellen, genannt Fuses. Der Begriff Fuse ist nicht im Sinn des deutschen Worts Sicherung zu verstehen, vielmehr als Schalter, den man schließen oder öffnen kann. Zwei davon lfuse und hfuse sind für uns von Interesse, von den anderen sollte man vorerst ganz die Finger lassen. Die einzelnen Bits in den Fuse-Bytes haben folgende Bedeutung.

Abbildung 32: Fuse-Bitwerte und ihre Bedeutung
Das Fuse Low Byte muss also geändert werden, wenn der AT Tiny 2313 fabrikneu ist. Das liegt daran, dass werkseitig der controllerinterne RC-Oszillator mit 8MHz eingestellt ist und die Taktfrequenz auf 1MHz gedrosselt ist. In diesem Zustand könnte man den AT Tiny 2313 also gänzlich ohne äußere Taktquellen betreiben.
Wir versorgen den Controller aber mit einer externen, viel genaueren Taktquelle (CKSEL3:0 = 0b0000) und wollen eine möglichst hohe Taktgeschwindigkeit erreichen. Also teilen wir nicht durch 8. Damit wird unser Wert von Lfuse zu 0xE0.
Wir fragen zuerst einmal die Fuse-Werte ab.
avrdude -v -pt2313 -cavrisp -PCOM6 -b19200
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: safemode: Fuses OK
Die Lfuse stellen wir jetzt auf 0xE0 um.
avrdude -v -pt2313 -cavrisp -PCOM6 -b19200 -Ulfuse:w:0xE0:m
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: reading input file "0xE0"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xE0:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xE0:
avrdude: input file 0xE0 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: safemode: lfuse reads as E0
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: safemode: Fuses OK
Wir haben somit die Taktquelle erfolgreich umgestellt. Das Herz unseres AT Tiny 2313 tickt jetzt mit 20MHz. Wenn wir das Lfuse-Bit CKOUT brennen würden, könnten wir den Kanal 3 des Logic Analyzers an PortD.2 anschließen und den Takt aufzeichnen, um ihn am Bildschirm darzustellen. Wie würde das Lfuse-Byte dafür lauten? – Klar: 0b10100000 = 0xA0.
Jetzt wollen wir aber endlich unser Programm zum AT Tiny 2313 schicken.
avrdude -v -pt2313 -cavrisp -PCOM6 -b19200 -Uflash:w:"tinytest.hex":i
Writing | ################################################## | 100% 1.02s
avrdude: 1280 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against tinytest.hex:
avrdude: load data flash data from input file tinytest.hex:
avrdude: input file tinytest.hex contains 1280 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.38s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1280 bytes of flash verified
avrdude: safemode: lfuse reads as E0
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: safemode: Fuses OK
Der AT Tiny 2313 arbeitet jetzt bereits mit dem neuen Programm. Schauen wir uns die Signale an PortD.4 und PortD.6 an. Der Logic Analyzer hängt ja hoffentlich schon am USB-Bus. Dann starten wir die Anwendung Logic2. Sobald die Verbindung zum Logic Analyzer steht, drücken wir zweimal kurz hintereinander die Taste R. Sie startet und stoppt die Aufzeichnung. Mit dem Scroll-Rad der Maus zoomen wir in die Kurven hinein.

Abbildung 33: Ermittlung des Timings mit dem Logic Analyzer
Die Berechnungen, die wir bei der Programmbesprechung aufgestellt haben, werden durch die Messung bestätigt. Mit diesen Werten sind wir auf der sicheren Seite, unseren DDS-Wellenform-Generator doch noch hinzukriegen.
Die nächste Aufgabe, die wir lösen müssen, ist die Umwandlung der Sinuswerte am Port B in Spannungswerte. Leider besitzt der AT Tiny 2313 keinen eingebauten DAC. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wie die ausschaut und wie es damit weitergeht, das lesen Sie in der nächsten Folge.
Also, bleiben Sie dran!